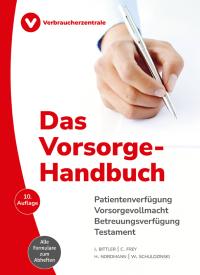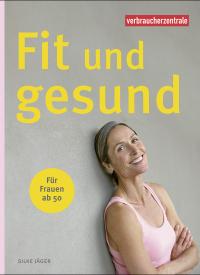Nicht jeder Kauf macht auch wunschlos glücklich. Manchmal folgt auch die Ernüchterung, z.B. wenn die Ware Mängel hat. Hier erfahren Sie, welche Möglichkeiten Sie mit Gewährleistung und Schadenersatz haben.
Gesetzliche Gewährleistung durch den Händler
Wenn Sie etwas gekauft haben, muss Ihnen der Verkäufer die Ware wie vereinbart, also frei von Mängeln, übergeben. Dieser Anspruch ist gesetzlich geregelt. Hat die gekaufte Ware einen Mangel, dann haben Sie Gewährleistungsrechte. Verwechseln Sie Gewährleistung nicht mit Garantie. Erstere ist ein gesetzliches Recht, das Sie gegenüber dem Verkäufer haben. Letztere ist eine freiwillige Leistung der Hersteller oder Händler. Die Informationen, welche Rechte die Garantie umfasst, finden Sie in den Garantiebedingungen.
Wichtig zu wissen: Auch als Privatverkäufer müssen Sie ihrem Vertragspartner einwandfreie Waren zuschicken. Bei Privatkäufen können jedoch abweichende Vereinbarungen greifen und die Gewährleistungsrechte ausgeschlossen werden. Achten Sie hier auf die richtige Formulierung.
Bei der Gewährleistung gilt: Sie können bei Mängeln an der Ware zunächst nur eine Ersatzlieferung verlangen oder eine Reparatur. Das nennen Jurist:innen "Nacherfüllung". In beiden Fällen trägt der Verkäufer die Kosten für Transport, Arbeitsleistung und Materialien. Er darf Ihnen beispielsweise weder Porto fürs Einsenden an den Verkäufer oder Hersteller noch Ersatzteil- und Lohnkosten berechnen. Ansprüche auf Nacherfüllung können Sie mit Hilfe des Umtausch-Checks der Verbraucherzentralen geltend machen.
Ob die gekaufte Ware repariert oder getauscht werden soll, dürfen Sie als Kunde entscheiden (§ 439 Absatz 1 BGB). Sie sind nicht an Ihre Wahl gebunden, können also auch zunächst eine Reparatur verlangen und später eine Ersatzlieferung. Der Verkäufer darf dabei nicht ohne Ihr Einverständnis Fakten schaffen: Verlangen Sie eine Reparatur, darf er nicht einfach ein Ersatzgerät liefern. Allerdings kann der Händler die gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, etwa wenn durch eine Reparatur unverhältnismäßig hohe Kosten entstehen (§ 439 Absatz 4 BGB).
Nacherfüllung durch Reparatur
Bei der Reparatur hat der Verkäufer nicht unbegrenzt Versuche. Das Gesetz sieht vor, dass Sie sie in der Regel höchstens zweimal dulden müssen, bevor Sie von Ihrem Recht auf Rücktritt oder Minderung Gebrauch machen können. In der Praxis kommt es aber auch auf den Einzelfall an. Gerichte haben schon die Ansicht vertreten, dass Sie bei technisch komplizierten Geräten wie einem Computer bis zu drei Versuche akzeptieren müssen.
Ist die Ware besonders sperrig oder zerbrechlich, können Sie auf eine Reparatur vor Ort bestehen. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit Urteil vom 23. Mai 2019 (Az. C-52/18) entschieden. Handelt es sich um Gegenstände, die Sie leicht selbst zur Post bringen können, kann der Verkäufer die Rücksendung verlangen. In allen Fällen muss der Händler die Kosten übernehmen. Sie können einen Vorschuss für die Transport- oder Versandkosten verlangen.
Nacherfüllung durch Ersatzlieferung
Wurde sich im Rahmen der Nacherfüllung für die Ersatzlieferung entschieden und ist der Mangel nochmal vorhanden, müssen Sie als Verbraucher:in in der Regel auch hier keine unbegrenzte Anzahl an Versuchen hinnehmen. In der Praxis kommt es jedoch immer auf den konkreten Einzelfall an. Ist zum Beispiel ein ausgetauschtes Bügeleisen nochmal defekt, können Sie in der Regel vom Vertrag zurücktreten und den Kaufpreis zurückverlangen.
Bekommen Sie für Ihr defektes Gerät ein Austauschgerät, beginnt dafür die Gewährleistung in der Regel erneut. Bestehen Sie also darauf, dass der Tausch dokumentiert wird, etwa durch einen Kassenbon.
Frist setzen für Nacherfüllung
Für die Nacherfüllung müssen Sie dem Verkäufer grundsätzlich eine angemessene Frist setzen. Hält er diese Frist nicht ein oder hat die Nacherfüllung keinen Erfolg, können Sie eine Herabsetzung des Kaufpreises verlangen (Minderung). Nutzen Sie dafür dieses Musterschreiben. Oder Sie machen den Vertrag rückgängig (Rücktritt). Läuft die von Ihnen gesetzte Frist zur Nacherfüllung erfolglos ab, dann können Sie zurücktreten und den Kaufpreis zurückverlangen.
Eine Fristsetzung brauchen Sie nicht, wenn:
- der Händler die Nacherfüllung verweigert hat,
- die Nacherfüllung nicht möglich ist
- oder Sie bereits zwei erfolglose Reparaturversuche hatten.
Bei den Waren, die Sie nach dem 1. Januar 2022 kaufen, müssen Sie, anders als früher, keine konkrete Frist für die Nacherfüllung setzen, sondern nur den Mangel anzeigen und Nacherfüllung verlangen. Aus Beweisgründen empfehlen wir weiterhin eine Fristsetzung.
In folgenden Situationen können Sie somit auch nach den neuen gesetzlichen Regelungen sofort zurücktreten:
- eine angemessene Frist ist bereits vergangen, nachdem Sie dem Unternehmer den Mangel mitgeteilt haben,
- es zeigt sich trotz der vom Unternehmer versuchten Nacherfüllung ein Mangel,
- der Mangel ist schwerwiegend,
- der Händler hat die Nacherfüllung verweigert oder es ist offensichtlich, dass der Unternehmer nicht nacherfüllen wird.
Im Rahmen eines Rücktritts hat der Verkäufer dann die Kosten und das Risiko für die Rücksendung zu tragen (§ 475 Abs. 6 BGB). Bewahren Sie deshalb den Nachweis über die Rücksendung auf.
Nur bei ganz unerheblichen Mängeln ist ein Rücktrittsrecht ausgeschlossen. Sie müssen dann sozusagen mit der defekten Sache leben und können nur eine Minderung, aber keinen Rücktritt, verlangen. Der Umfang des Preisnachlasses bei der Minderung richtet sich nach dem Ausmaß des Mangels.
Tritt in den ersten zwei Jahren nach dem Kauf ein Mangel auf, muss der Händler aktiv werden. Die Praxis sieht anders aus, wie eine Umfrage der Verbraucherzentralen von 2018 zeigt. Händler schinden Zeit, schieben die Schuld auf Kund:innen oder Hersteller und nutzen Unwissen aus.
Möchten Sie Ansprüche geltend machen, wenn die Ware Mängel aufweist? Dann hilft Ihnen der Umtausch-Check der Verbraucherzentralen. Dort finden Sie den passenden Musterbrief.